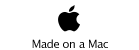Geschichte der Synagoge Stavenhagen

Entstehung der Synagoge und die jüdische Gemeinde in Stavenhagen
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ließen sich mehrere jüdische Familien in Stavenhagen nieder. Unter dem Schutz des Herzogs, den sie mit jährlich zwölf Talern bezahlen mussten, war es Juden nun erlaubt, in der Stadt zu leben und Handel zu treiben.
Anfang des 19. Jahrhunderts, vermutlich um 1820, baute die jüdische Gemeinde von Stavenhagen in der Malchiner Straße in Hinterhoflage eine Fachwerksynagoge. Sie bestand aus einem großen Betsaal mit einem kleinen Vorraum, von dem eine Treppe auf die Frauenempore führte. Die Synagoge war durch das an der Straße gelegene Rabbiner- und Schulhaus erreichbar und zwar für Männer und Frauen durch separate Eingänge. Von einer Mikwe (rituelles Tauchbad) gibt es leider keine Überreste mehr und es ist unklar, wo sich diese obligate Einrichtung befand. Der Bau von kleinen Fachwerksynagogen war in Mecklenburg weit verbreitet und entsprach den geringen finanziellen Mitteln der Gemeinden. Da die jüdische Gemeinde Stavenhagen vergleichsweise gut situiert war, wurde zum Bau der Synagoge qualitativ hochwertiges und teureres Eichenholz verwendet. Dies zahlte sich nun, fast 200 Jahre später, bei den Wiederaufbauarbeiten aus, da viele Originalelemente verwendet werden konnten.
Mit rund 130 Gemeindemitgliedern war Stavenhagen 1843 die fünft größte jüdische Gemeinde im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Bis etwa 1850 stieg die Zahl der Gemeindemitglieder auf 150 an und erlebte damit ihren Höhepunkt. Mit dem Beitritt von Mecklenburg-Schwerin zum Norddeutschen Bund 1867 erhielten Juden und Jüdinnen die Bürgerrechte und die Erlaubnis, in Großstädte zu ziehen und auszuwandern. Viele jüdische Familien nahmen ihr neu gewonnenes Recht wahr und so schrumpfte die jüdische Gemeinde Stavenhagen innerhalb von 20 Jahren auf 57 Personen.
Die Gemeinde unternahm mehrmals Renovierungsarbeiten an der Synagoge, zuletzt in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhundert. Zu diesem Zeitpunkt gehörten der Gemeinschaft noch 30 Personen an. Bis in die 1930er Jahre fanden regelmäßig Gottesdienste statt, die 1935 jedoch eingestellt werden mussten, da die Gemeinde nicht länger die zur Durchführung des Gottesdienstes erforderlichen zehn männlichen Mitglieder hatte. Von da an stand die Synagoge leer.
Nationalsozialismus und Nachkriegszeit
Im April 1938 zählte die jüdische Gemeinde Stavenhagen noch 13 Mitglieder. Der letzte Rabbiner der Gemeinde, Sally Schlachter, lebte mit seiner Frau noch bis zum 7. September 1938 in der Malchiner Straße 38 im Vorderhaus und floh dann nach England.
Als am 9. November 1938 in der Reichspogromnacht in ganz Deutschland gewaltsame Angriffe auf Juden und Jüdinnen sowie jüdische Einrichtungen verübt wurden, blieb auch die Synagoge in Stavenhagen nicht verschont. Die Innenausstattung mit Aron Hakodesch (Toraschrein) und Bima (Tora-Lesepult) wurde zerschlagen. Der vorsätzlich in der Synagoge gelegte Brand wurde jedoch vom Schuhmachermeister Bilsath rechtzeitig gelöscht, wahrscheinlich befürchtete er ein Übergreifen des Feuers auf sein benachbartes Haus. Im Zuge der von den Nationalsozialisten durchgesetzten Arisierung jüdischen Besitzes verkaufte die jüdische Landesgemeinde Mecklenburg am 2. März 1939 Synagoge und Rabbinerhaus an den Tischler Carl Dubbert, der den Betraum umbaute, um ihn als Werkstatt zu nutzen. Mit seiner Familie wohnte er im Vorderhaus.
1942 wurden die letzten acht jüdischen Einwohner Stavenhagens nach Auschwitz deportiert und ermordet. An sie erinnern Stolpersteine vor ihren früheren Wohnhäusern.
Verfall und Rettung der Synagoge
Nach Carl Dubberts Tod 1952 wurde die Synagoge weiter zum Lagern von Holz und als Werkstatt benutzt. Seit 1986 standen Synagoge und Vorderhaus leer und blieben dem Verfall überlassen. Noch zu DDR-Zeiten wurde die Synagoge allerdings unter Denkmalschutz gestellt und man fertigte eine bautechnische Dokumentation an. Die jüdischen Spuren in Stavenhagen drohten dennoch vergessen zu werden und die Synagoge wurde lediglich als marodes und baufälliges Gebäude wahrgenommen.
Da die Jewish Claims Conference keine Ansprüche auf die Synagoge oder das Rabbinerhaus geltend machte, wurden diese 1994 auf die Erbengemeinschaft von Carl Dubbert übertragen und von dieser auf seine Enkelin Rosemarie Rieger. Die Synagoge verfiel weiter und drohte völlig einzustürzen, bis 1996 auf Kosten der Stadt Stavenhagen eine Notsicherung unternommen wurde. Die dabei abgetragene Südwand wurde großenteils eingelagert und konnte beim Wiederaufbau integriert werden. Rosemarie Rieger sanierte das baufällige Vorderhaus, für den Wiederaufbau der Synagoge fand sich jedoch lange keine Lösung.
Schließlich gründete sich am 30. Mai 2011 der Verein „Alte Synagoge Stavenhagen e.V.“, eines der Gründungsmitglieder war Rosemarie Rieger. Sie übertrug dem Verein das Erbbaurecht über das Synagogengrundstück, was mit der Zweckbestimmung verbunden wurde, das Gebäude wieder so herzurichten, dass es dem Gedenken an die Juden Stavenhagens dient und für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann.
Inzwischen ist der Wiederaufbau vollendet.
Literaturhinweise:
Jürgen Borchert, Detlef Klose: Was blieb... Jüdische Spuren in Mecklenburg; Verlag: Haude & Spener; 1994
Angelika Hergt, Schwerin et Al.: Zeugnisse jüdischer Kultur; Verlag: Tourist Verlag GmbH, Berlin; 1992

Die Synagoge ist eine der ganz wenigen ursprünglich erhalten gebliebenen Synagogen in Mecklenburg-Vorpommern. Das Foto zeigt den Zustand im Jahre 1988.